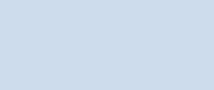
|
C II 12 Rüti (Prämonstratenser), 1219-1835 (Fonds)
| Ref. code: | C II 12 |
| Title: | Rüti (Prämonstratenser) |
| Inhalt und Form: | 48 Schachteln, 2353 Nummern. |
| Creation date(s): | 1219 - 1835 |
| Number: | 582 |
| Aktenbildner: | Das ehemalige Prämonstratenserkloster und spätere Klosteramt Rüti wurde zwischen 1206 und 1208 von Lütold V. von Regensberg und seinem Sohn anfänglich als Marien- und von den Regensbergern bevogtete Eigenkirche in Rüti ZH gestiftet. Der klostereigene Gründungsbericht von 1441, der sich auf den ersten Seiten des Diplomatars von Rüti (B I 278) findet, beschreibt, wie Propst Ulrich das Kloster Churwalden im Streit verliess und, zusammen mit einem weiteren Konventualen, 1206 durch den Bau einer hölzernen Kapelle die Grundlage für das Kloster legte, nachdem er - so die Gründungsgeschichte - vom göttlich in seiner Entscheidung bestärkten Lütold von Regensberg das Gut Rüti erhalten hatte. Der Besitz stammte aus dem umstrittenen Erbe der hochfreien Herren von Alt-Rapperswil, bei dem besonders auch die Herren von Toggenburg und von Neu-Rapperswil ihr Anrecht einforderten. Erwin Eugster (Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz, 1991) geht von Rechten aus, "welche die Regensberger nach 1192 unter Berufung auf eine weiter zurückliegende Verwandtschaft mit den Alt-Rapperswilern usurpiert hatten." Unter dem Druck der Erbschafts-Konkurrenten übertrugen die Regensberger trotz dieser Rechte zwischen 1209 und 1217 die Kirche Rüti an den Churwaldner Propst Ulrich und seine Chorherren zur Errichtung einer - direkt dem Vogtrecht der Regensberger unterstellten - Prämonstratenserabtei. Der genannte Zeitraum von acht Jahren ist durch die Überlieferung zweier Urkunden eingegrenzt: Während in der ersten noch jegliche Hinweise auf eine Prämonstratenserabtei fehlen (C IV 7.3.6, Nr. 1; UBZH, Bd. 1, Nr. 363 [1209]), zeichnet sich die zweite durch die explizite Erwähnung des Probsts Ulrich und der Errichtung eines Prämonstratenserklosters aus (C IV 2.3, Nr. 1; UBZH, Bd. 1, Nr. 382 [1217]). Auch diese Umwandlung führte - zusammen mit den Bemühungen Lütolds VI. von Regensberg, seinen Herrschaftsbereich im Zürcher Oberland mithilfe von Stadtgründungen, wie dem Städtchen Grüningen, zu festigen - zu Auseinandersetzungen zwischen den Regensbergern und den Erben der Alt-Rapperswiler. Deswegen wurde schliesslich 1219 eine Einigung angestrebt, worin die Regensberger zugunsten der konkurrierenden Adelsgeschlechter - allen voran wiederum die Toggenburger und Neu-Rapperswiler - auf jegliche Vogteiabgaben Rütis verzichteten, dafür aber die Schirmvogtei behalten und dem Konvent weitere Rechte aus dem Erbe der Alt-Rapperswiler, unter anderem Besitztümer bei Seegräben, übertragen konnten.
Besitz und Bedeutung der Abtei wuchsen im 13. und 14. Jahrhundert schnell an. Der Hauptbesitz konzentrierte sich vor allem in Rüti/Ferrach und Oberdürnten sowie in abgeschwächtem Masse bei Seegräben, Wermatswil, Fehraltorf und Eschenbach SG. Dieser umfangreiche, verhältnismässig geschlossene Kernbesitz machte das Kloster zu einer der wichtigsten Grundherrschaften des Zürcher Oberlandes. Die Konzentrationen erklären sich zumindest teilweise aus den Kirchenpatronaten, die das Kloster für Rüti, Seegräben, Eschenbach SG, Dürnten, Bollingen SG und Dreibrunnen SG innehatte (zu denen im Verlauf des 15. Jahrhunderts noch weitere hinzukamen). Von den 95 Titeln der Abtei fielen rund zwei Drittel auf Streubesitzungen, die vom schwyzerischen Wägital bis an den Rhein reichten. 1251 wurde das von Rudolf von Rapperswil gestiftete Frauenkloster Bollingen dem Prämonstratenserorden einverleibt und dem Abt von Rüti die Paternität über die Schwestern verliehen. Bereits 1267 trat Bollingen jedoch zum Zisterzienserorden über und schloss sich dem Kloster Wurmsbach an.
Das Kloster Rüti war seit 1230 eine Tochterabtei des Prämonstratenserklosters Weissenau, das die Verwaltung Rütis bis zu dessen Aufhebung 1525 mitprägte. Auch mit anderen Niederlassungen der Prämonstratenser in der Zirkarie Schwaben stand Rüti im Austausch. Im Jahr 1468 schloss es einen Verbrüderungsvertrag mit dem Kloster Churwalden, welcher die gegenseitige Ausrichtung von Seelenmessen für Verstorbene und die gastliche Aufnahme von Brüdern regelte (C II 12, Nr. 481). Einfluss nahmen zudem die nahegelegenen Johanniter- sowie Benediktiner-Konvente Bubikon und St. Johann im Thurtal, die ebenfalls im Kontext des Alt-Rapperswiler Erbstreits entstanden. Das Kloster führte ein eigenes Spital, das im Jahr 1282 zum ersten Mal erwähnt wurde (C II 12, Nr. 31; UBZH, Bd. 5, Nr. 1860). Die Existenz eines Siechenhauses wurde noch in der Übereinkunft mit der Stadt Zürich anlässlich der Aufhebung des Klosters (siehe unten) bestätigt.
Vom späten 13. Jahrhundert an entwickelte sich Rüti zur wichtigsten Grablege für den ostschweizerischen Adel und zu einem Zentrum für die sich daran knüpfende Memoria. An erster Stelle standen die Grafen von Toggenburg, die bis zu ihrem Aussterben im Jahr 1436 eine Grabkapelle mit Gruft in der Klosterkirche besassen. Ebenfalls über eine eigene Gruft verfügten die Herren von Hinwil. Abgesehen vom Hochadel fanden aber auch Ministerialengeschlechter wie die Meier von Dürnten, die von Schalchen und von Rambach ihre Ruhestätte im Kloster Rüti. Im Jahr 1389 wurden dort die in der Schlacht bei Näfels auf österreichischer Seite gefallenen Krieger bestattet. Unter ihnen war auch Ritter Hans von Wagenberg, der Bruder des damaligen Abtes Bilgeri. Die rund 50 Jahre nach den Ereignissen entstandene Klingenberger Chronik berichtet, wie der Abt die auf dem Schlachtfeld vergrabenen Toten mit Erlaubnis der Glarner exhumierte und zur ordentlichen Bestattung in sein Kloster überführte. Das Diplomatar enthält auch eine Jahrzeitstiftung für den ebenfalls in der Schlacht gefallenen Ritter Hans von Klingenberg (B I 278, S. 571-572).
Mit der Stadt Zürich schloss Rüti im Jahr 1401 ein Burgrecht ab, welches das Kloster in städtischen Schutz nahm und gleichzeitig den Einfluss Zürichs stärkte (C II 12, Nr. 261; URStAZH, Bd. 4, Nr. 4542). Im Zuge der Reformation hob der Zürcher Rat am 17. Juni 1525 den Konvent auf und schloss mit den Brüdern ein Abkommen, das ihnen den Verbleib im Kloster auf Lebzeiten garantierte (A 142.4, Nr. 36 und E I 1.1, Nr. 28; Egli, Actensammlung, Nr. 752). Der letzte Abt, Felix Klauser, floh hingegen nach Rapperswil und vermochte einen Teil des Archivs und der Klosterschätze dorthin zu überführen. In den folgenden Jahrzehnten unternahm der Prämonstratenserorden verschiedene - erfolglose - Versuche zur Wiederherstellung des Klosters. Den entschiedensten Vorstoss diesbezüglich lancierte der letzte lebende Konventuale, Sebastian Hegner, in den 1550er Jahren unter Einbezug der Tagsatzung, wobei auch das mittlerweile nach Weissenau gelangte Klosterarchiv Gegenstand der Auseinandersetzungen war (siehe unten, Fondsgeschichte).
Zürich führte wie anderorts nach der Reformation das Kloster als Wirtschaftseinheit weiter und setzte städtische Amtleute ein, um die umfangreichen Güter und die damit verbundenen Einnahmen zu verwalten. Dabei blieben auch die Bauern in den benachbarten katholischen Gebieten (namentlich Gaster) gegenüber dem zürcherischen Klosteramt Rüti abgabepflichtig. Die Amtleute hatten sich gegenüber dem Rechenrat zu verantworten, wobei sich aufgrund von Bereicherungsvorwürfen verschiedene Konflikte ergaben, die im Jahr 1551 sogar zur Hinrichtung des Amtmannes Rudolf Kolb durch die Stadt führten (B VI 257, fol. 240 r-v). Im Jahr 1624 setzte Zürich eine umfangreiche Reform der Amtsverwaltung in Kraft, die unter anderem die Ausgaben für Angestellte der Verwaltung sowie die Verteilung der Almosen durch das Klosteramt betraf (C II 12, Nr. 1015). Die Residenz des Zürcher Amtmannes wurde 1706 aufgrund eines schweren Feuers fast vollständig zerstört und durch einen repräsentativen Neubau ersetzt. Dieses noch heute stehende Amtshaus und die Klosterkirche stellen gemeinsam die beiden einzigen noch intakten vormodernen baulichen Zeugen des ehemaligen Klosterkomplexes dar. |
| Fondsgeschichte: | Das Archiv des Klosters Rüti und des gleichnamigen Klosteramtes umfasst Urkunden, Urbare, Zins- und Zehntverzeichnisse, Rechnungsbücher sowie umfangreiche Aktenbestände. Die im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts einsetzenden Urkunden sind auf mehrere heutige Archivabteilungen verteilt. So bilden die Rechtstitel, die in Bezug zur näheren Umgebung des Klosters (das sogenannte Amt Rüti) stehen, den Bestand C II 12. Die dem Amtshaus des Klosters in Winterthur zugehörigen Urkunden wurden hingegen dem um 1540 gegründeten Amt Winterthur zugeteilt (C II 16). Das Rütiamt in der Stadt Zürich wurde um 1546 mit dem sogenannten hinteren Amt, das die Einkünfte der drei ehemaligen Bettelordensklöster verwaltete, zusammengelegt (C II 8, ‘Hinterrütiamt’). Im 19. Jahrhundert aus den Aktenbeständen ausgeschiedene Urkunden finden sich in C IV 2.3.
Die Urkunden dokumentieren unter anderem die von den Prämonstratensern intensiv betriebene Erwerbung von Kollaturrechten sowie von Widumgütern und Zehntrechten (vgl. zum Beispiel C II 12, Nr. 482: Verkauf des Laienzehnten sowie Schenkung von Kirchensatz und Kirche in Fehraltorf von Herdegen von Hinwil und seiner Ehefrau Margareta an das Kloster Rüti). Eine eigentliche Gründungsurkunde ist nicht überliefert; die frühesten Stücke betreffen Schenkungen der Grafen von Regensberg. Lütold VI. von Regensberg bestätigte am 6.5.1219 zusammenfassend die durch seinen Vater vorgenommenen Vergabungen, behielt sich aber die Vogtei und das Patronatsrecht über das Kloster vor (C IV 2.3, Nr. 2; UBZH, Bd. 1, Nr. 391). Hervorzuheben sind weiter auch die päpstlichen Bestätigungen klösterlicher Rechte; als erster nahm Papst Gregor IX. 1228 den Konvent in apostolischen Schutz und verlieh ihm verschiedene Privilegien (C IV 2.3, Nr. 5; UBZH, Bd. 1, Nr. 444). Insgesamt 410 Abschriften von teilweise nicht mehr im Original überlieferten Urkunden finden sich in dem 1441/1442 angelegten Diplomatar, dessen Anfang die in Latein verfasste Gründungsgeschichte bildet (B I 278). Aus dem seit der Mitte des 14. Jahrhunderts verdichtet überlieferten Verwaltungsschriftgut sind das Urbar von 1371 (A 142.1.1) sowie das Amtsbuch des Klosters Rüti hervorzuheben (A 142.1.3, fol. 14r-79v). Den normativen Quellen wie Urkunden, Urbarien, Amtsbuch und Diplomatar stehen als Beleg für den Ist-Zustand die ab 1423 einsetzenden Zins- und Zehntverzeichnisse sowie die zwischen 1479 und 1496 überlieferten Rechnungen gegenüber (A 142.1-3). Für die nachreformatorische Verwaltung der Klostergüter durch die Amtleute der Stadt Zürich ist insbesondere auf drei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandene Urbare (F II a 367-369) sowie die ausführlichen Rechnungen hinzuweisen, die der von der Stadt eingesetzte Amtmann gegenüber dem Zürcher Rechenrat abzulegen hatte (F III 28).
Im Anschluss an die Reformation gelangten zumindest Teile des Archivs in das Prämonstratenserkloster Weissenau; der letzte Abt Felix Klauser hatte dieses gemeinsam mit dem Kirchenschatz bei seiner Flucht nach Rapperswil überführt und anschliessend dem Abt von Weissenau als seinem Ordensoberen ausgehändigt. Ein Teil der Archivalien scheint jedoch in Rüti verblieben zu sein, da der Chronist Johannes Stumpf in seiner Amtszeit als Dekan des oberen Wetzikoner Kapitels 1532-1543 dort eine Urkunde des Jahres 1259 konsultieren konnte. Der Verbleib des Archivs rückte in den 1550er Jahren wieder auf die Tagesordnung, als sich der Abt von Weissenau vor der Tagsatzung um eine Wiederherstellung des Klosters Rüti bemühte. Darin wurde er ab 1557/58 von Sebastian Hegner von Winterthur unterstützt, der bis kurz davor als letzter Konventuale noch in Rüti gelebt hatte und nun nach Rapperswil übergesiedelt war. Die Auseinandersetzung begann am 30. November 1557 mit einem Auftritt Hegners vor den Boten von Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus (EA, Bd. 4/2, S. 57). Bei dieser Gelegenheit forderte Hegner, alle Einkünfte und Güter Rütis ausserhalb des zürcherischen Gebiets mit Arrest zu belegen. Dies untermauerte er, in Kenntnis der im Klosterarchiv überlieferten Rechtstitel, mit dem Stifterwillen sowie der im Burgrecht von 1401 verbrieften Schirmpflicht, gegen die Zürich durch die Klosteraufhebung verstossen habe). Die Tagsatzung setzte daraufhin ein Schiedsgericht ein, um über die Streitsache zu entscheiden. Diesem gehörte Aegidius Tschudi, Landammann von Glarus, an, der sich nebenbei auch als Chronist für das Klosterarchiv interessierte. Eine auf Hegner antwortende Darlegung des Zürcher Standpunkts (und eine erneute Erwiderung Hegners) fand im Juni 1558 statt (EA, Bd, 4/2, S. 69). Am 4. Dezember 1558 schliesslich machte Zürich die Fortführung der Verhandlungen ausdrücklich von der Herausgabe der Urkunden und weiterer Dokumente abhängig (EA, Bd. 4/2, S. 86). Der in C I, Nr, 2382 dokumentierte Schiedsspruch führte im Januar 1559 schliesslich eine Einigung herbei. Der Spruch garantierte Hegner ein lebenslanges Einkommen, überwies die Frage einer Wiederherstellung des Klosters jedoch an das Konzil. Ein eigener Punkt betraf die Dokumente des Klosterarchivs: Diese sollten bis auf Weiteres bei Schultheiss und Rat von Baden zur beidseitigen Nutzung verbleiben. In den Aktenbeständen befindet sich eine mit "Stadtschreiber von Baden" unterschriebene Abschrift der Urkunde (Registraturtitel: "Endtliche beyleggung des lang-geschwebten spans zwischen mein gnädig herren und dem ausgetrettenen Convent-herren Baschi Hegner zu Rüthi, 1559", A 142.4, Nr. 174). Laut den Ratsmanualen zahlte Zürich dem Stadtschreiber von Baden 18 Kronen "für den vertrags brief gegen verlaugneten münchen zu Rüti" sowie jedem der drei Siegler 2 Kronen, wobei die Bezahlung aus dem Rüti-Amt erfolgte (B II 106, S. 14. April 1559). Salomon Vögelin schätzte die Bedeutung des Schiedsvertrags folgendermassen ein: "Durch diese Bestimmung ward den Zürchern die reichhaltigste Geschichtsquelle für den ganzen östlichen Kantonsteil erhalten." (Vögelin 1869, S. 17, Anm. 1)
Wie lange das Archiv nach dem Schiedsspruch tatsächlich noch in Baden verblieben ist, lässt sich (nach heutigem Wissensstand) nicht genauer bestimmen. Allenfalls in diesen Kontext gehört die Nachricht aus dem Januar 1561, einige Zinsleute in der March hätten den Zürchern die Zinsen für Rüti verweigert und Vorweisung der Briefe verlangt (EA, Bd. 4/2, S. 164). Die Rückgabe der Archivalien an Zürich muss jedenfalls vor dem Jahr 1706 erfolgt sein. Im Nachgang zum Brand des Amtshauses und eines Teils der Klosterkirche im Dezember dieses Jahres berichtete der damalige Amtmann Johannes Herrliberger an den Zürcher Rat, er habe in letzter Minute "die schrifften und anders, so vil immer möglich, zusammen geworffen und zur flucht fertig gemacht" (A 142.7, Nr. 4). Wenig später befahl ihm der Rechenrat, eine Aufstellung über das nach dem Brand noch vorhandene Getreide zu erstellen und sämtliche "amts urbaria und dergleichen oberkeitliche schrifften" in die Stadt zu senden (A 142.7, Nr. 4). Gemäss Salomon Vögelin wurde in der Zeit nach dem Brand schliesslich das gesamte Klosterarchiv wieder in Zürich vereinigt, wobei ein Teil in die Sakristei des Grossmünsters, der andere ins Fraumünster gelangte.
Die Übersichtstexte zu Aktenbildner und Fondsgeschichte sind im Rahmen des Pilotprojekts Vormoderne Quellen im Jahr 2021 durch Anina Steinmann und Michael Schaffner verfasst worden. |
| Publications: | Helvetia Sacra, Abt. 4, Bd. 3, S. 501-531, bes. S. 520-522 (Archivgeschichte)
Backmund, Norbert, Monasticon Praemonstratense, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin und New York 1983, S. 72-74
Eugster, Erwin: Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz. Kirchliche Stiftungen im Spannungsfeld früher landesherrlicher Verdrängungspolitik, Zürich 1991.
Largiadèr, Anton: Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum, Zürich 1963, S. 248-249.
Niederhäuser, Peter: Das Zürcher Amt Rüti und die Konfessionsgrenze - eine nachreformatorische Klosterherrschaft in der March, in: MHVS 113, 2021, S. 77-88.
Niederhäuser, Peter: Vom Kloster zum Amthaus. Die Folgen der Reformation in Rüti, in: Heimatspiegel 2020, S. 65-71.
Niederhäuser, Peter: Die letzten Mönche von Rüti: eine Klosteraufhebung mit Nachwirkungen, in: Heimatspiegel 2010, S. 73-79.
Niederhäuser, Peter: " Weisse Mönche", Zürcher Amtsmänner und der Feuerteufel: 800 Jahre Prämonstratenserkloster Rüti, in: Heimatspiegel 2006, S. 49-55.
Schweizer, Paul: Die Behandlung der zürcherischen Klostergüter in der Reformationszeit, in: Theologische Zeitschrift aus der Schweiz 2, 1885, S. 1-22.
Sieber, Christian: Kloster Rüti, in: Aegidius Tschudi. Chronicon Helveticum. Hilfsmittel 1. Teil: Verzeichnis der Dokumente. Verzeichnis der Lieder, Basel 2001, S. 80-81.
Vögelin, Friedrich Salomon: Die Aufhebung des Klosters Rüti: ein Beitrag zur Reformationsgeschichte (Neujahrsgabe für Uster 4), Uster 1869.
Zangger, Alfred: Grundherrschaft und Bauern. Eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung der Grundherrschaft der Prämonstratenserabtei Rüti (ZH) im Spätmittelalter, Zürich 1991.
Zangger, Alfred: Das Amtsbuch der Prämonstratenserabtei Rüti. Lizentiatsarbeit Historisches Seminar Universität Zürich, Zürich 1983.
Zuppinger, Johann Conrad: Die Prämonstratenser-Abtei Rüti, Rüti 1894 |
| Related material: | C II 8 (Hinterrütiamt) und C II 16 (Winterthur); C IV 2.3 |
| Level: | Fonds |
| Ref. code AP: | C II 12 |
| |
Related units of description |
| Related units of description: | Siehe:
C II 8 Hinterrütiamt (Augustineramt und Rütiamt Zürich), 1265.06-1430.05.20 (Fonds)
Siehe:
C II 16 Winterthur (Franziskaner auf Beerenberg, Chorherren auf Heiligenberg, Rütiamt Winterthur, Petershausen, Paradies), 1337.06.15-1460.06.23 (Fonds)
Siehe:
C IV 2.3 Rüti, 1217-1576 (Klasse)
Siehe:
B I 278 Kopialbuch des Klosters Rüti (Diplomatar von Rüti), 1441 (Dossier)
Siehe:
KAT 376 Rüti, Klosteramt: Standortverzeichnis der Urkunden, 1531 (ca.)-1537 (ca.) (Dossier)
|
| |
Usage |
| Permission required: | [Leer] |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | [Leer] |
| |
URL for this unit of description |
| URL: |  https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=273633 https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=273633 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|